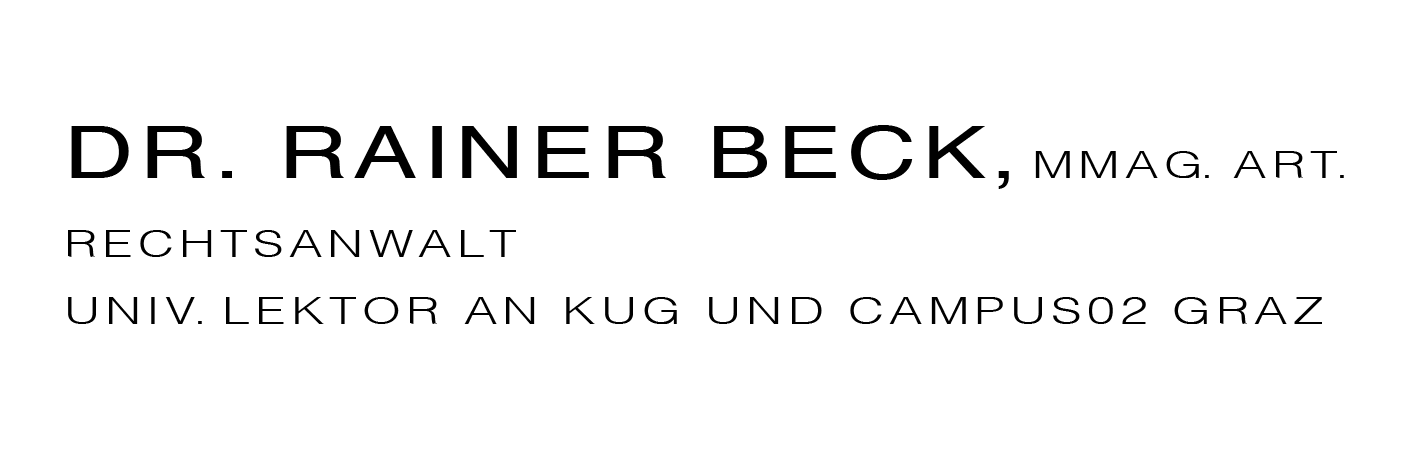Wie verhält es sich mit Unterrichtsmaterialien?
Nach § 42 Abs. 6 UrhG dürfen unter anderem Schulen und andere Bildungseinrichtungen, also auch Musikschulen für Unterrichtszwecke in dem dadurch gerechtfertigten Umfang Kopien für eine bestimmte Schulklasse bzw. Lehrveranstaltung herstellen (Vervielfältigung zum eigenen Schulgebrauch) und auch an die Schüler austeilen, das gilt auch für Musiknoten. Auf Papier ist das jedenfalls zulässig, auf anderen Materialien wie auf Digitalträgern darf das nur zu nicht-kommerziellen Zwecken geschehen. Ausgenommen von dieser gesetzlichen Erlaubnis sind approbierte Schulbücher, aus denen darf so nicht kopiert werden.
Nach § 42g UrhG dürfen Schulen und andere Bildungseinrichtungen wie etwa Musikschulen für Zwecke des Unterrichts und auch der Lehre für die Teilnehmer am Unterricht Werke online zur Verfügung stellen, allerdings nur für den abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern und nur soweit das wirklich notwendig ist. Kommerzielle Zwecke dürfen damit nicht verfolgt werden.
Auch hier gilt diese Ausnahme nicht für approbierte Schulwerke.
Hier ist es allerdings so, dass den Urhebern ein Anspruch auf angemessene Vergütung zusteht, der von Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden kann. Es kann also sein, dass Verwertungsgesellschaften beim Träger der Schule entsprechende Auskünfte einholen und letztlich Tantiemen vorschreiben, üblicherweise aber im überschaubaren geringen Ausmaß.
Unter diese Ausnahme fällt auch etwa ein downgeloadeter Popsong, den man so an Teilnehmer des Unterrichts weiterleiten kann, selbstverständlich nur für nicht-kommerzielle Zwecke.
Diese Ausnahme gilt für alle Werkkategorien, also Text, Musik, Bildende Kunst und auch Film wie etwa Videos.